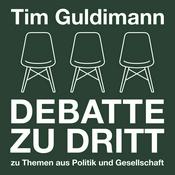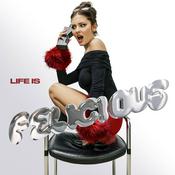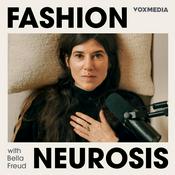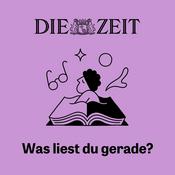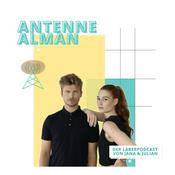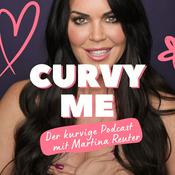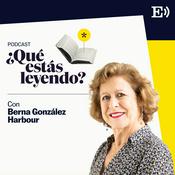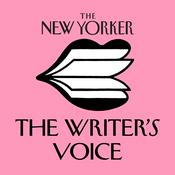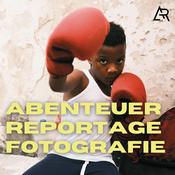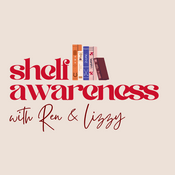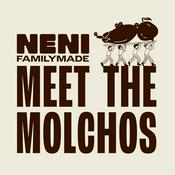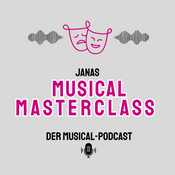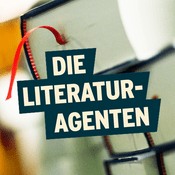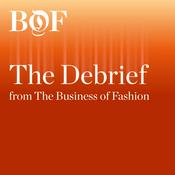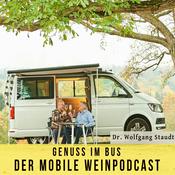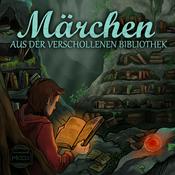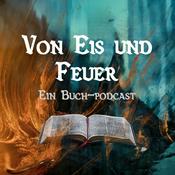86 Episoden
Trockengelegte Moore sind immense CO-2-Schleudern. Warum sind sie der blinde Fleck der heutigen Klimadebatte? - mit Franziska Tanneberger und Bernhard Kegel
20.1.2026 | 44 Min.Das Thema meiner neusten Debatte ist noch nicht im breiten Bewusstsein angekommen: Trockengelegte Moore verursachen sieben Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland, deutlich mehr als, was alle Wälder des Landes absorbieren können. Weltweit produzieren sie mehr Treibhausgase als der gesamte Luftverkehr. Die Wieder-Vernässung der Moore ist eine der effizientesten und kostengünstigsten Hebel im Klimaschutz, um die Erderwärmung zu bremsen.
Darüber diskutiere ich mit Franziska Tanneberger, Moorforscherin und Leiterin des Greifswald Moor Centrums. Sie wurde 2024 mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Und mit dem Biologen, Schriftsteller und Autor Bernhard Kegel. Sein Buch „Mit Pflanzen die Welt retten“ wurde für den Deutschen Sachbuchpreis 2025 nominiert.
Nasse Moore speichern viel CO-2 über sehr lange Zeiträume. Da aber früher die allermeisten Moore – in Deutschland 90-95 Prozent aller Moorflächen - trockengelegt worden sind, gelangen von ihnen anhaltend grosse Mengen CO-2 in die Atmosphäre. „Moor muss nass“, um das Problem zu lösen. Das passiert allein, wenn ihre mit grossem Aufwand betriebene Entwässerung gestoppt wird. Kegel argumentiert: „Ohne die Moore wieder zu vernässen, erreichen wir die Klimaziele in keinem Fall“.
Tanneberger hält es „für besonders wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was für Alternativen können wir auf diesen (wieder-vernässten) Flächen anbieten, sei es Paludikultur, also Landwirtschaft auf nassen Boden, sei es Fotovoltaik, sei es Naturtourismus (..) Wasserbüffel gehören zur Paludikultur, kann man ja toll Mozarella draus machen. (..) Das ist totales Neuland, was man da betritt. Unsere Landwirtschaft auf trockenen Böden hat sich ja seit Tausenden Jahren entwickelt (..) und wir haben ein Paradigma, dass für Landwirtschaft der Boden trocken sein muss.“
Die meisten Bauern auf trockengelegten Mooren „sind durch Investitionen vielleicht gebunden. (..) Das heisst, die Handlungsspielräume sind vielleicht gar nicht so gross, sofort was zu ändern. Landwirte oder Eigentümer sagen, ‘wir wollen hier nicht als Verbrecher dastehen. Aber wir können doch nicht unser ganzes Wirtschaftsmodell übern Haufen werfen. Wer bezahlt uns das denn?‘ Grundsätzlich glaube ich, dass die Bereitschaft zu diesen Veränderungen da ist. (..) Ich bin sehr der Ueberzeugung, wir müssen erst mal Angebote dahaben.“ Dafür gebe es von der Regierung eine Förderrichtlinie, „auf die sehr gewartet wird, die dann ein Volumen von zwei Milliarden Euro haben soll. Da soll richtig Geld mobilisiert werden.“
Lesetipp zu den Büchern von Kegel und Tanneberger:https://bernhardkegel.de/mit-pflanzen-die-welt-retten/https://www.dtv.de/buch/das-moor-28324
Link zum Greifswalder Moor Centrumhttps://www.greifswaldmoor.de/ueber-uns.html«Who is Benjamin Netanjahu?» - with Netanyahu‘s former Inteligence Advisor Uri Halperin and Bente Scheller, Heinrich Böll Foundation
05.1.2026 | 45 Min.In meiner neuen Folge der „DEBATTE ZU DRITT“ - dieses Mal auf Englisch – diskutiere ich über die Person des israelischen Ministerpräsidenten aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, einerseits mit Uri Halperin; er war Oberst im israelischen Geheimdienst und stand mit Netanyahu im engen persönlichen Kontakt als dessen Berater für nachrichtendienstliche Fragen; andererseits mit Bente Scheller. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Region und ist heute Leiterin der Mittelost/Nordafrika-Abteilung der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin.
Halperin sieht in Netanyaju einen Führer, der von einer bestimmten Machtlogik getrieben wird: „Netanjahu ist ein sehr talentierter Mensch, er ist redegewandt und hochgradig kultiviert, aber er kann auch sehr rücksichtslos sein, insbesondere gegenüber denen, die er als seine politischen Feinde betrachtet.» Halperin erwähnt seine fehlende Empathie gegenüber den Familien der von der HAMAS verschleppten Geiseln, «weil er glaubt, dass sie Teil der Opposition gegen ihn seien».
Bente Scheller verweist auf die Folgen dieser Logik über die Grenzen Israels hinaus und sieht «eine Reihe verpasster politischer Chancen (..), weil der Fokus auf militärischen Siegen liegt. Dieser Fokus auf Macht, statt auf politischer Verantwortung prägt auch Netanjahus Umgang mit Verbündeten. Scheller warnt vor den Folgen für Israel aus der wachsenden einseitigen persönlichen Abhängigkeit seiner Politik von Präsident Trump.
Gleichzeitig vermeide Netanyahu, so Halperin, «politische Positionen, sondern setze immer auf militärische Aktionen, einige davon (..) waren eindeutig erfolgreich, aber er erlaubt sich nicht, die politische Ebene einzubringen, vor allem, weil er von politischen Minderheiten erpresst wird. (..) Das schafft die Instabilität, die Netanyahu braucht, um politisch zu überleben (..) Chaos gibt Netanyahu mehr Zeit in seinem Amt. (..) Seine Position, politisch und persönlich zu überleben und nicht im Gefängnis zu landen, tötet Israel mit jeder Entscheidung, die er trifft. (..) Zurzeit gibt es einen Wettstreit zwischen zwei Vektoren, der erste ist das Gerichtsverfahren (..) und der zweite ist Netanyahus Vektor, der das Rechtswesen zerstören will, das ihn vielleicht für schuldig erklärt. Und in diesem Wettstreit ist Netanyahu vielleicht im Vorteil. (..) Wenn er im nächsten Jahr die Wahlen gewinnt, müssen wir vielleicht ein nicht-demokratisch-rechtsstaatliches Israel erwarten, so wie wir es bisher gewohnt sind».
Was mich in dieser Debatte überrascht hat, ist die radikale Kritik des früheren persönlichen Beraters von Netanyahu. Dieser sei daran, in Israel Demokratie und Rechtsstaat auszuhebeln, nur um seine eigene Macht zu erhalten."Haben die Grünen Zukunft und wie stehen sie zur Wehrpflicht und zum Schutz von Rechtsstaat und Demokratie?" – mit Anja Hajduk und Robert Pausch
18.12.2025 | 50 Min.Darüber diskutiere ich mit Anja Hajduk, langjährige Bundestagsabgeordnete und von 2021 bis 2025 als Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, quasi als rechte Hand von Robert Habeck, sowie mit Robert Pausch, Autor bei der ZEIT.
Anja Hajduk sieht im Ende der Ampel eine tiefe Bruchstelle: „Wenn eine Regierung vorzeitig zerbricht, ist das nicht der Normalfall. Das ist ein ganz besonderes Scheitern. (..) Die Regierung ist zerbrochen und dieses Zerbrechen hat zur grossen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. (..) Eine Regierung muss das Ziel haben, gemeinsam mit der Unterschiedlichkeit der Partner Erfolg haben zu wollen. Und das ist etwas, was im Laufe der Ampel verloren gegangen ist. Und das gillt für alle drei Partner. Und deswegen müssen die Grünen (..) analysieren (..) was haben wir selber zu dem Spiel beigetragen“.
Zu aktuellen Themen räumt Haiduk ein: „Es ist ein bisschen verpasst worden, das Thema: Wie stellen wir uns zur Wehrpflicht, wie stellen wir uns zu einem Pflichtjahr über alle Altersgruppen hinweg? […] Das ist eine Frage, wo es eine hohe gesellschaftliche Aufmerksamkeit im Moment gibt.“
Robert Pausch beschreibt, warum gerade dieses Thema so explosiv ist: „Es ist eines der Themen, auf dem gerade politische Energie drauf ist und irgendeine Art von Mobilisierungsfähigkeit, die aber bisher komplett vorbeiläuft an den Grünen […] nämlich irgendwie die Frage: Muss ich da jetzt auch an die Waffe?“
Hajduk entwirft den breiteren Rahmen: „Die ganz große Frage, die wir haben, ist nicht auf das Spektrum der Mitteparteien gerichtet, sondern die große Auseinandersetzung findet statt zwischen demokratischen Parteien, zwischen Demokratie und Autokratie.“ Und sie warnt vor zu viel Vorsicht: „Man muss schon mutig an die Gesellschaft herantreten. Ich glaube, dass die Gesellschaft eher ein bisschen die Nase voll hat, wenn sie so vorsichtige Antworten spürt, als wenn man etwas vor ihnen verheimlichen müsste.“
Die ganze Debatte hört ihr im Podcast 🎧
Wie seht ihr das: Braucht es von den Grünen eine klarere Haltung zur Wehrpflicht und wie könnte sie beitragen, Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaat zu stärken?“Is Europe ready to defend itself against Russian aggression?” - with Nicole Deitelhoff and Ben Hodges
13.11.2025 | 43 Min.Liegt in der russischen Aggression eine Kriegsgefahr für Europa? Die Welt steht in Flammen und ich frage den ehemaligen Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa, Ben Hodges und die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff: Ist Europa gerüstet? – Die Debatte führt am Ende zu einer überraschend optimistischen Einschätzung.
Was halten der ehemalige US-General und die Leiterin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung von der Solidarität innerhalb der NATO, ihrer Widerstandskraft und der Verlässlichkeit der transatlantischen Allianz? Was will Putin mit dem Krieg in der Ukraine eigentlich erreichen mit seinem Versuch die NATO zu provozieren und zu spalten?
Nicole Deitelhoff meint: „Wir sind in einer Nicht-Friedensphase, aber nicht in einer Vor-Kriegsphase.“ Für sie steckt hinter Putins Strategie: „It is not about waging war against Western Europe. It is about getting Europe away from Ukraine’s side.”
Und Ben Hodges ist überzeugt: „Putin fears not NATO armies or forces on his border. What he fears is an Ukraine that is liberal, democratic, free, prosperous.“
Am Ende geht es um ‘German Leadership‘ in Europa. Gegen den verbreiteten Alarmismus und die Selbstzweifel zeichnet Hodges ein anderes Bild von Sicherheit: kooperativ und europäisch. Der ehemalige US-Armee General sieht in der deutschen Zurückhaltung Pragmatismus und Stärke: „ I think Germany is leading by doing.“
Die Debatte ist diesmal in Englisch, hört trotzdem rein und vielleicht teilt Ihr den Optimismus.„Soll das Bundesverfassungsgericht die AfD verbieten?" - mit Gertrude Lübbe-Wolff und Norbert Lammert
17.10.2025 | 44 Min.Kann das Bundesverfassungsgericht neutral bleiben, wenn das Land sich spaltet? In anderen Staaten – in den USA, in Ungarn, Italien und zuvor in Polen - versucht der Rechtspopulismus, die Gerichte unter seine Kontrolle zu bringen. Die Frage kann sich auch in Deutschland stellen. Soll die AfD verboten werden und was bedeutet das für die Demokratie? Wie politisch ist das Bundesverfassungsgericht? Es steht nach der Nicht-Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf als Richterin im Zentrum einer Debatte über Macht, Verantwortung und Vertrauen. Dabei geht es generell um das Verhältnis zwischen Politik und richterlicher Gewalt in Zeiten, wo Demokratie und Rechtsstaat nicht mehr selbstverständlich sind.
Ich spreche mit Gertrude Lübbe-Wolff, ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, und Norbert Lammert, langjähriger Bundestagsabgeordneter und während 12 Jahren Bundestagspräsident. Gemeinsam diskutieren wir, wie unabhängig das Gericht wirklich ist, wie Richterinnen und Richter in Karlsruhe gewählt werden und welchen politischen Einfluss es hat.
Soll das Gericht die AfD verbieten? - Norbert Lammert warnt: „Das Verbotsverfahren gegen die AfD wäre ein politischer und juristischer Höllenritt.“ - Gertrude Lübbe-Wolff hält ein Parteiverbot ebenfalls für problematisch. Sie befürwortet es aber, gegen extremistische Parteifunktionäre das im Grundgesetz vorgesehene Instrument der Grundrechtsverwirkung zu nutzen.
Eine Debatte über Vertrauen in Institutionen, über die Grenzen richterlicher Macht und über die Frage, wie weit Karlsruhe gehen darf, wenn die Demokratie sich selbst verteidigen muss.
Weitere Kunst Podcasts
Trending Kunst Podcasts
Über Tim Guldimann - Debatte zu Dritt
Der Podcast von Tim Guldimann nimmt aus Politik und Gesellschaft relevante Fragen auf, die über die Tagesaktualität hinausgehen. Die prominenten Gesprächspartner – jeweils eine Frau und ein Mann – sind selbst im Themenbereich aktiv tätig. Monatlich werden laufend zwei neue Debatten aufgenommen. Tim Guldimann leitete Friedensmissionen im Kaukasus und Balkan, war Schweizerischer Botschafter in Teheran und Berlin und war danach bis 2018 Schweizerischer Parlamentsabgeordneter.
Podcast-WebsiteHöre Tim Guldimann - Debatte zu Dritt, life is felicious und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.de-App
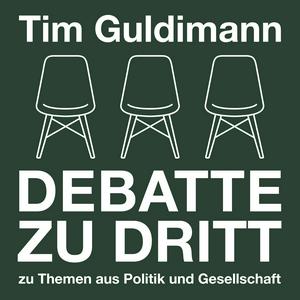
Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen

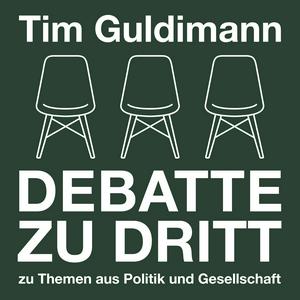
Tim Guldimann - Debatte zu Dritt
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.