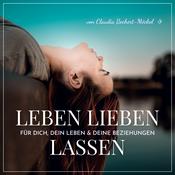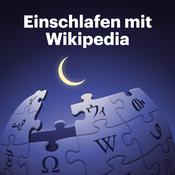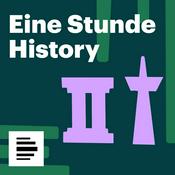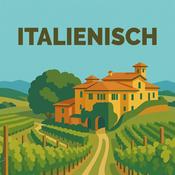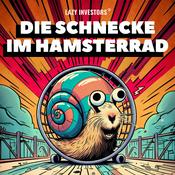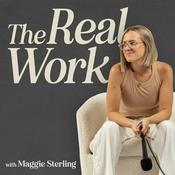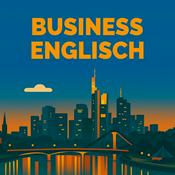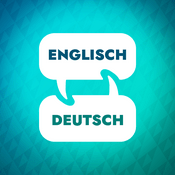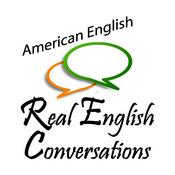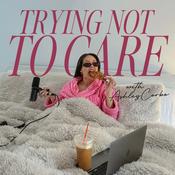Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg
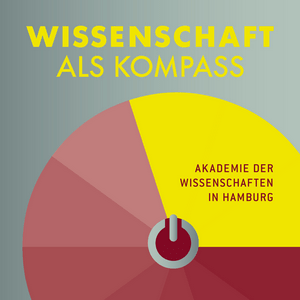
31 Episoden

„Wissenschaft für die Gesellschaft“: Wie funktioniert Rechtswissenschaft als „Transformationstool“?
23.9.2025 | 38 Min.
Mit einer Doppel-Folge geht die erste Staffel des Akademie-Podcasts „Wissenschaft als Kompass“ auf die Zielgerade: Akademiepräsident Prof. Dr. Mojib Latif und Young Academy Fellow Prof. Dr. Dana-Sophia Valentiner erläutern in zwei gut halbstündigen Gesprächen ihre Sicht auf das Thema „Wissenschaft für die Gesellschaft“. Valentiner beschäftigt als Rechtswissenschaftlerin unter anderem die Frage: Wie funktioniert Rechtswissenschaft als „Transformationstool“? Dana-Sophia Valentiner liegt über ihre Forschung hinaus Wissenschaftskommunikation besonders am Herzen. Unter anderem ist sie seit fünf Jahren Host von „Justitias Töchter“, dem „Podcast zu feministischer Rechtspolitik“ des Deutschen Juristinnenbundes. Als Young Academy Fellow hat Valentiner an der Arbeit der Akademie mitgewirkt, so insbesondere als Mitglied der Arbeitsgruppe „Wasserstoff für das norddeutsche Energiesystem“. Sie schätzt den interdisziplinären Austausch, den die Wissenschaftlerin auch aus ihrer eigentlichen Forschungsarbeit kennt. Als Professorin für Öffentliches Recht arbeitet sie an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg / Universität der Bundeswehr mit Schwerpunkt im öffentlichen Wirtschaftsrecht und im Recht der Transformation. Zu ihren Interessensgebieten gehören Grundrechte, das Recht der Verkehrswende und Legal Gender Studies. Wie auf diesen Feldern und bei den Themen Gleichberechtigung und Vielfalt eine „Wissenschaft für die Gesellschaft“ gelingen kann, auch davon berichtet Dana-Sophia Valentiner im Podcast. Für sie ist Recht „Hoffnungsträger und Transformationstool“ zugleich. „Wissenschaft für die Gesellschaft“: Unter dieser Überschrift steht das Jubiläumsjahr der Akademie zu ihrem 20-jährigem Bestehen. Dem Staffel-Finale vorausgegangen sind 14 Folgen, in denen es um ein breites Themenspektrum ging – von Klima- und Infektionsforschung über islamwissenschaftliche und archäologische Themen bis hin zu Einblicken in verschiedene Langzeitforschungsvorhaben im Akademienprogramm. Das Gespräch fand am 18. August 2025 statt. Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg: https://www.awhamburg.de/mediathek/podcasts.html Jubiläumsprogramm 2025 „Wissenschaft für die Gesellschaft“: https://www.awhamburg.de/magazin/jubilaeumsjahr-2025.html Arbeitsgruppe „Wasserstoff für das norddeutsche Energiesystem“: https://www.awhamburg.de/forschung/arbeitsgruppen/wasserstoff.html Podcast „Justitias Töchter“: https://justitias-toechter.podigee.io/ Mehr zu Prof. Dr. Dana-Sophia Valentiner: https://www.awhamburg.de/akademie/young-academy-fellows/detail/dr-iur-dana-sophia-valentiner.html

„Wissenschaft für die Gesellschaft“: Welchen Beitrag leisten Wissenschaftsakademien?
23.9.2025 | 28 Min.
Mit einer Doppel-Folge geht die erste Staffel des Akademie-Podcasts „Wissenschaft als Kompass“ auf die Zielgerade: Akademiepräsident Prof. Dr. Mojib Latif und Young Academy Fellow Prof. Dr. Dana-Sophia Valentiner erläutern in zwei gut halbstündigen Gesprächen ihre Sicht auf das Thema „Wissenschaft für die Gesellschaft“. Latif blickt als Präsident und Klimaforscher aus verschiedenen Perspektiven auf die Frage: Welchen Beitrag leisten Wissenschaftsakademien? Als Akademiepräsident betont er das Engagement der Akademie im Jubiläumsjahr unter dem Motto „Wissenschaft für die Gesellschaft“. So nimmt die Akademie durch die Einrichtung und Betreuung zahlreicher Arbeits- und Projektgruppen auch gesellschaftliche Anliegen in den Fokus. Ziel des vielfältigen Angebots an kostenfreien Veranstaltungen ist es, die Bedeutung wissenschaftlicher Arbeit für die Gesellschaft sichtbar zu machen und den gesellschaftlichen Diskurs aktiv zu fördern. Latif geht auch auf die bedeutenden Langzeitforschungsprojekte der Akademie ein: Sie liefern mit Blick auf das kulturelle Erbe der Menschheit wertvolle Erkenntnisse über Geschichte, Traditionen und deren Bedeutung für die Gegenwart. Wissenschaftsakademien bieten ihren Mitgliedern Freiräume, die sie nutzen können, zum Beispiel mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die Wissenschaftsfreiheit. In diesem Zusammenhang berichtet der Akademiepräsident von der letzten Akademie-Klausur zum Thema „Vertrauen in die Wissenschaft“. So seien „Transparenz“ von Forschung und das Verständnis von Wissenschaft als Prozess zentral. „Wissenschaft für die Gesellschaft“: Unter dieser Überschrift steht das Jubiläumsjahr der Akademie zu ihrem 20-jährigem Bestehen. Dem Staffel-Finale vorausgegangen sind 14 Folgen, in denen es um ein breites Themenspektrum ging – von Klima- und Infektionsforschung über islamwissenschaftliche und archäologische Themen bis hin zu Einblicken in verschiedene Langzeitforschungsvorhaben im Akademienprogramm. Das Gespräch fand am 18. August 2025 statt. Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg: https://www.awhamburg.de/mediathek/podcasts.html Jubiläumsprogramm 2025 „Wissenschaft für die Gesellschaft“: https://www.awhamburg.de/magazin/jubilaeumsjahr-2025.html Jahresthema „Vielfalt“: https://www.awhamburg.de/forschung/publikationen/essays-1.html „Akademie aktuell“: https://www.awhamburg.de/mediathek/akademie-aktuell.html Arbeitsgruppen der Akademie: https://www.awhamburg.de/forschung/arbeitsgruppen.html Langzeitforschung der Akademie: https://www.awhamburg.de/forschung/langzeitvorhaben.html Ausstellung „Notwendig, nützlich, neu - Langzeitforschung in Hamburg“: https://www.awhamburg.de/magazin/ausstellung-zur-langzeitforschung-in-hamburg.html Mehr über Prof. Dr. Mojib Latif: https://www.awhamburg.de/mitglieder/ordentliche-mitglieder/detail/prof-dr-mojib-latif.html

Wie lässt sich Musikgeschichte neu schreiben? Einblicke in das Forschungsprojekt „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“
23.7.2025 | 20 Min.
Wie lässt sich Musikgeschichte neu schreiben? Für das Langzeitforschungsprojekt „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“ bedeutet das zunächst einmal, Biographien von verfolgten Musikerinnen und Musikern der NS-Zeit zu rekonstruieren und auch Geo-Daten der Lebenswege zu analysieren. Wie aber lassen sich die Biographien recherchieren? Welche Fragen erwachsen aus dieser Grundlagenforschung? Und mit welchen Zielen startet das noch neue Langzeitforschungsprojekt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg in die 18 Jahre lange Laufzeit? Diese und andere Fragen beantwortet Projektleiter Prof. Dr. Friedrich Geiger in Folge 14 des Akademie-Podcasts „Wissenschaft als Kompass“. Die Zeit des Nationalsozialismus ist auch mit Blick auf die Musikgeschichte eines der düstersten historischen Kapitel. Die Musikgeschichtsschreibung sähe anders aus, hätte es den Terror des NS-Regimes nicht gegeben. Reichhaltige, aber bisher nicht ausgeschöpfte Quellen warten darauf erschlossen zu werden, um eben die Musikgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts zu revidieren, das heißt unter anderem, sie zu korrigieren und zu präzisieren. Gerade auch verfolgte und ermordete Personen können so mit ihrem Schaffen einen angemessenen Platz in der Musikgeschichte einnehmen. Die Forschung auf diesem Feld bekommt jetzt einen neuen Schub: Seit Beginn des Jahres 2025 gibt es an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg das neue Langzeitvorhaben „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“: Das neue Projekt wird über 18 Jahre bis Ende des Jahres 2042 laufen. In Folge 14 des Akademie-Podcasts „Wissenschaft als Kompass“ gibt Projektleiter Prof. Dr. Friedrich Geiger Einblicke in die konkrete Arbeit, die Methoden und die übergeordneten Themen, die auf Basis der vorgenommenen Grundlagenforschung zu bearbeiten sind. So lassen sich voraussichtlich durch gruppenbiographische Erkenntnisse präzisere Aussagen treffen zu bestimmten Berufsgruppen beispielsweise im Bereich Komposition, Oper oder auch Jazz. Auf Grundlage der Geo-Daten in den recherchierten Biographien erfolgen raumzeitliche Analysen der Musikerverfolgung: Spezielle Kartographien machen so etwa sichtbar, wie sich Musikerinnen und Musiker auf der Flucht und im Exil gegenseitig beeinflusst haben. „NS-Verfolgung und Musikgeschichte. Revisionen aus biographischer und geographischer Perspektive“: So lautet der vollständige Titel des Langzeitforschungsprojekts, das im Rahmen des Akademienprogramms angesiedelt ist; Kooperationspartnerinnen sind die Universität Hamburg und die Hochschule für Musik und Theater München. Hier arbeitet Friedrich Geiger als Professor für Historische Musikwissenschaft. Die Forschung zu Musik in Diktaturen und im Exil gehört seit rund 30 Jahren zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Sie hören Auszüge aus dem Gespräch mit Professor Dr. Friedrich Geiger; die Podcast-Folge haben wir am 12. Mai 2025 aufgenommen. Neben der Gesprächsfassung unseres Podcasts „Wissenschaft als Kompass“ bieten wir immer ein kürzeres Schlaglicht auf zentrale Aspekte der langen Gesprächsfassung. Durch den Podcast führt Dagmar Penzlin. Die langjährige Radiojournalistin ist Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg: https://www.awhamburg.de/mediathek/podcasts.html Mehr zum Langzeitvorhaben „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“: https://www.awhamburg.de/forschung/langzeitvorhaben/ns-verfolgung-und-musikgeschichte.html Zum Online-Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit (LexM): https://www.lexm.uni-hamburg.de/ Mehr über Prof. Dr. Friedrich Geiger: https://mw.hmtm.de/index.php/personen2/25-prof-dr-friedrich-geiger

Für eine neue Musikgeschichtsschreibung. Das Akademieprojekt „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“
21.7.2025 | 1 Std. 17 Min.
Wie lässt sich Musikgeschichte neu schreiben? Für das Langzeitforschungsprojekt „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“ bedeutet das zunächst einmal, Biographien von verfolgten Musikerinnen und Musikern der NS-Zeit zu rekonstruieren und auch Geo-Daten der Lebenswege zu analysieren. Wie aber lassen sich die Biographien recherchieren? Welche Fragen erwachsen aus dieser Grundlagenforschung? Und mit welchen Zielen startet das noch neue Langzeitforschungsprojekt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg in die 18 Jahre lange Laufzeit? Diese und andere Fragen beantwortet Projektleiter Prof. Dr. Friedrich Geiger in Folge 14 des Akademie-Podcasts „Wissenschaft als Kompass“. Die Zeit des Nationalsozialismus ist auch mit Blick auf die Musikgeschichte eines der düstersten historischen Kapitel. Die Musikgeschichtsschreibung sähe anders aus, hätte es den Terror des NS-Regimes nicht gegeben. Reichhaltige, aber bisher nicht ausgeschöpfte Quellen warten darauf erschlossen zu werden, um eben die Musikgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts zu revidieren, das heißt unter anderem, sie zu korrigieren und zu präzisieren. Gerade auch verfolgte und ermordete Personen können so mit ihrem Schaffen einen angemessenen Platz in der Musikgeschichte einnehmen. Die Forschung auf diesem Feld bekommt jetzt einen neuen Schub: Seit Beginn des Jahres 2025 gibt es an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg das neue Langzeitvorhaben „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“: Das neue Projekt wird über 18 Jahre bis Ende des Jahres 2042 laufen. In Folge 14 des Akademie-Podcasts „Wissenschaft als Kompass“ gibt Projektleiter Prof. Dr. Friedrich Geiger Einblicke in die konkrete Arbeit, die Methoden und die übergeordneten Themen, die auf Basis der vorgenommenen Grundlagenforschung zu bearbeiten sind. So lassen sich voraussichtlich durch gruppenbiographische Erkenntnisse präzisere Aussagen treffen zu bestimmten Berufsgruppen beispielsweise im Bereich Komposition, Oper oder auch Jazz. Auf Grundlage der Geo-Daten in den recherchierten Biographien erfolgen raumzeitliche Analysen der Musikerverfolgung: Spezielle Kartographien machen so etwa sichtbar, wie sich Musikerinnen und Musiker auf der Flucht und im Exil gegenseitig beeinflusst haben. „NS-Verfolgung und Musikgeschichte. Revisionen aus biographischer und geographischer Perspektive“: So lautet der vollständige Titel des Langzeitforschungsprojekts, das im Rahmen des Akademienprogramms angesiedelt ist; Kooperationspartnerinnen sind die Universität Hamburg und die Hochschule für Musik und Theater München. Hier arbeitet Friedrich Geiger als Professor für Historische Musikwissenschaft. Die Forschung zu Musik in Diktaturen und im Exil gehört seit rund 30 Jahren zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Das Gespräch fand am 12. Mai 2025 statt. Moderation: Dagmar Penzlin, Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg: https://www.awhamburg.de/mediathek/podcasts.html Mehr zum Langzeitvorhaben „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“: https://www.awhamburg.de/forschung/langzeitvorhaben/ns-verfolgung-und-musikgeschichte.html Zum Online-Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit (LexM): https://www.lexm.uni-hamburg.de/ Magda Spiegel im LexM: https://www.lexm.uni-hamburg.de/object/lexm_lexmperson_00002664 Sabine Kalter im LexM: https://www.lexm.uni-hamburg.de/object/lexm_lexmperson_00000960 Jazz-Label Blue Note: https://www.bluenote.com/ Christina Richter-Ibáñez: Mauricio Kagels Buenos Aires (1946-1957) => https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2662-9/Mauricio-Kagels-Buenos-Aires-1946-1957/ Mehr über Prof. Dr. Friedrich Geiger: https://mw.hmtm.de/index.php/personen2/25-prof-dr-friedrich-geiger

Wie entsteht die historisch-kritische Edition vom Etymologicum Gudianum? Einblicke in das Langzeitvorhaben „Etymologika“
21.8.2024 | 19 Min.
Die griechischen etymologischen Wörterbücher beleuchten die antike und mittelalterliche Wissensgeschichte in Europa. Diese Etymologika zählen zu den bedeutendsten griechisch-byzantinischen Lexika. Bis in die Renaissance und Neuzeit hinein waren sie in Gebrauch. Eines der zentralen Etymologika ist das Etymologicum Gudianum. Es steht im Mittelpunkt des Langzeitvorhabens „Etymologika. Ordnung und Interpretation des Wissens in griechisch-byzantinischen Lexika bis in die Renaissance. Digitale Erschließung von Manuskriptproduktion, Nutzerkreisen und kulturellem Umfeld“. Ein langer Projekt-Titel, der umreißt, wie umfangreich die Grundlagenforschung sich hier über einen Zeitraum von 18 Jahren gestaltet. Es ist ein Langzeit-Forschungsprojekt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg in Kooperation mit der Universität Hamburg im Rahmen des Akademienprogramms. Der Projekt-Titel deutet es schon an, dass in dem Thema „Etymologika“ viele spannende Forschungsfelder stecken. Und der Name dieser griechisch-byzantinischen etymologischen Wörterbücher, eben der Etymologika, bezieht sich auf die Suche nach dem étymon, das heißt der wahren Bedeutung, eben der Essenz eines Wortes. Zu den zentralen Aufgaben dieses Forschungsprojekts gehört es, eine historisch-kritische Edition vom Etymologicum Gudianum zu erstellen. In diesem Zusammenhang entsteht eine Übersetzung des griechischen Originaltextes ins Englische. Eine vorläufige kritische Online-Edition ist seit Sommer 2024 zugänglich. Darüber hinaus wird ab 2026 Band für Band eine Buch-Edition vom Etymologicum Gudianum erscheinen. Wie bewältigt das interdisziplinär besetzte „Etymologika“-Team diese große Aufgabe? Wie ist die Quellenlage? Und welche Vorgehensweise hat sich bewährt? Fragen, die Professor Dr. Christian Brockmann in unserem Podcast „Wissenschaft als Kompass“ beantwortet: Er ist Professor für Klassische Philologie an der Universität Hamburg, seit 2021 Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, und er leitet das „Etymologika“-Langzeitvorhaben. Sie hören Auszüge aus dem Gespräch mit Professor Dr. Christian Brockmann; die Podcast-Folge haben wir am 26. Juni 2024 aufgenommen. Neben der Gesprächsfassung unseres Podcasts „Wissenschaft als Kompass“ bieten wir immer ein kürzeres Schlaglicht auf zentrale Aspekte der langen Gesprächsfassung. Durch den Podcast führt Dagmar Penzlin. Die langjährige Radiojournalistin ist Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg: https://www.awhamburg.de/mediathek/podcasts.html Mehr zum Langzeitvorhaben „Etymologika“: https://www.awhamburg.de/forschung/langzeitvorhaben/etymologika.html Zur Online-Edition vom Etymologicum Gudianum: https://www.etymologika.uni-hamburg.de/en/resources/webapp-intro.html Ineke Sluiter: „Ancient Etymology: a Tool for Thinking" => https://www.academia.edu/23962217/ANCIENT_ETYMOLOGY_A_TOOL_FOR_THINKING_1 Suda On Line: Byzantine Lexicography => https://www.cs.uky.edu/~raphael/sol/sol-html/ Mehr über Prof. Dr. Christian Brockmann: https://www.awhamburg.de/mitglieder/ordentliche-mitglieder/detail/prof-dr-christian-brockmann.html
Weitere Bildung Podcasts
Trending Bildung Podcasts
Über Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg
Höre Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, Hörsaal - Deutschlandfunk Nova und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.de-App
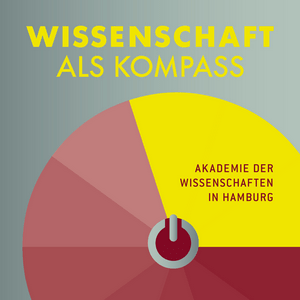
Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen

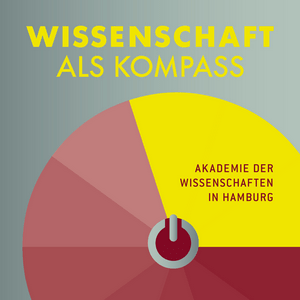
Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg
App laden,
loshören.