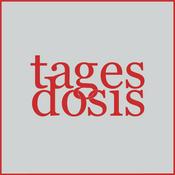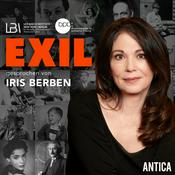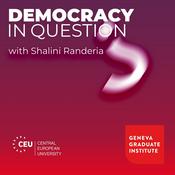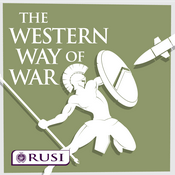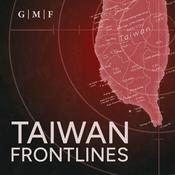69 Episoden
(68) Psychologische Dimensionen hybrider Kriegsführung und demokratische Widerstandskraft. Mit Marina Weisband
18.12.2025 | 47 Min.Deutschland befindet sich im Krieg, einem hybriden Krieg. Neben Spionage und Cyberangriffen ist vor allem die Bevölkerung das Angriffsziel. „Die öffentliche Meinung wird tatsächlich gezielt und sehr, sehr strukturiert angegriffen, und zwar seit etwa 2015. Und das ist natürlich mit das Gefährlichste, was man machen kann, wenn das Ziel eine Demokratie ist, wenn also die öffentliche Meinung schließlich zu policy wird.“
Im Atlantic Talk Podcast analysiert Marina Weisband die Mechanismen russischer Einflussnahme und zeigt am Beispiel des gesellschaftlichen Zusammenhalts der Ukrainerinnen und Ukrainer Wege zur Stärkung demokratischer Widerstandskraft auf. Sie beschreibt, welche Methoden, die sie seit der Annexion der Krim genau beobachtet hat, heute auch in Deutschland angewendet werden. In der Ukraine verbreiteten Bot-Armeen gezielt Desinformation, posteten manipulierte Fotos und pushten die Nazi-Erzählung. Seit 2015 seien viele dieser Bots, die vorher vermeintliche Ukrainer waren, vermeintliche Deutsche geworden.
Der Mechanismus dahinter ist simpel aber fatal: Von Sozialen Medien sickern Desinformationen auch in die großen Medien. Erzählungen beispielsweise über nie wirklich geschehene sexuelle Belästigungen durch Migranten seien gezielt gestreut worden. „Dann haben echte Journalisten das aufgegriffen. Dann haben echte Menschen sich Sorgen gemacht. Und dann kam es zu Talkshows rund um das Thema.“
Weisband erläutert im Gespräch mit Moderator Dario Weilandt, wie leicht die mediale Öffentlichkeit zu beeinflussen sei. Besonders fatal sei das Zusammenspiel von Medienlogiken und ihrer Mitschuld, einer Politik, die ohne Emotion und Vision kommuniziert, und gezielten Angriffen aus dem Ausland, die diese Schwachstellen ausnutzen.
Der Schlüssel zur ukrainischen Widerstandskraft liege in einem fundamentalen Wandel während der Maidan-Bewegung: „Es entstand dort etwas, das ich der Ukraine nie zugetraut hätte aus der Geschichte heraus, nämlich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, ein Gefühl von: Das ist unser Platz.“ Diese Ownership wirke: „Wenn ich Ownership über eine Gesellschaft habe, dann verteidige ich die Gesellschaft. Dann fühle ich mich mehr in Kontrolle. Je mehr ich mich in Kontrolle fühle, desto ruhiger bin ich, desto reflektierter kann ich gucken.“
Genau davon brauche es mehr in Deutschland: mehr Zusammenhalt, mehr Selbstwirksamkeit. Dazu sei Bürgerbeteiligung wichtig. Die Politik insgesamt und insbesondere auch die Europäische Union brauche eine emotionale Erzählung für ihre positive Macht: „Die EU ist das, was zwischen dem absoluten Monopol steht – Digital-Feudalismus, auf den wir gerade mit großen Schritten zusteuern – und Demokratien.“- Karl-Theodor zu Guttenberg nennt als Vorbild das Land auf Platz 1 des World Happiness Index: Finnland. Dort, wo die Menschen besonders glücklich sind, gibt es hohes Vertrauen in die Regierung und öffentliche Institutionen, weil dort Politik Lage und Entscheidungen nicht nur erklärt, sondern auch zuhört, transparent und ehrlich kommuniziert. Das gelinge dort auch bei sicherheitspolitischen Themen gut, während Finnland gleichzeitig eines der am meisten bedrohten Länder Europas sei.
Als Karl-Theodor zu Guttenberg 2009 Verteidigungsminister wurde, bestimmten vor allem abstrakte Bedrohungen und Auslandseinsätze die sicherheitspolitische Agenda. Über die Realität des Afghanistan-Einsatzes beispielsweise habe damals ein „Deckmantel des Schweigens“ gelegen. – Er habe versucht, offen und ohne Euphemismen darüber zu kommunizieren. Das sei auch für die heutige Situation der richtige Weg.
Während seiner Amtszeit setzte er die Wehrpflicht aus – eine damals richtige Entscheidung, wie er sagt. Heute habe sich die Lage aber grundlegend verändert: Russland führe nicht nur Krieg in der Ukraine, sondern bedrohe ganz Europa und das NATO-Bündnisgebiet mit fast täglichen Cyberangriffen, Sabotageakten und Drohnenüberflügen. „Ich gehe schon so weit, dass ich sage: Wir befinden uns – Europa – bereits in einem Krieg.“ Über die Konsequenzen daraus müsse offener gesprochen werden – ohne Angst vor Reaktionen in der Debatte.
Die Dringlichkeit sicherheitspolitischer Entscheidungen müsse in einer realitätsbezogenen Kommunikation oft wiederholt werden, das gehe auch ohne „Tonalität des Säbelrasselns“. Inder Narrative wie „Nie wieder Krieg“ und „Frieden schaffen ohne Waffen“ seien tief in der Gesellschaft verankerte Wünsche, blieben historisch betrachtet aber fast immer eine Utopie. Er findet: „Frieden schaffen, ohne Waffen einzusetzen, aber sie gleichzeitig zu haben, um zu vermeiden, dass die andere Seite, die auch über sie verfügt, sie selbst einsetzt“, das müsse das Ziel sein und auch so formuliert werden, auch wenn es „ein Halbsatz mehr“ sei.
Im Gespräch mit Atlantic Talk-Moderator Dario Weilandt plädiert zu Guttenberg für eine Streitkultur mit mehr Substanz, Respekt und ernsthaftem Zuhören – sowohl in der Öffentlichkeit als auch im familiären und gesellschaftlichen Umfeld. Am Ende dieser Podcast-Folge verrät „KT“ zu Guttenberg, wie er sich selbst nennt, seine drei Grundsätze für ein Kommunikationskonzept für deutsche Sicherheitspolitik. (66) Freiheit schätzen, Freiheit schützen – eine gemeinsame Aufgabe für die abschreckungsfähige Gesellschaft
11.9.2025 | 1 Std. 4 Min.„Es muss uns gelingen, aus dieser latenten Angst Selbstbewusstsein zu machen, dass diese Gesellschaft mit anderen zusammen in der Lage ist, einen solchen Krieg zu verhindern“, sagt Sigmar Gabriel, „und zwar dadurch, dass wir uns so stark machen, dass keiner auf die Idee kommt, mit einem Krieg anzufangen.“
Der SPD-Politiker und frühere Stellvertreter der Bundeskanzlerin erklärt auch, was dazu seiner Meinung nach vor allem nötig ist: „Die wichtigste Voraussetzung dafür, einen potenziellen Angreifer aus Russland abschrecken zu können, ist, dass eine Gesellschaft sich ihrer Lage bewusst ist. Erstens, dass es etwas zu verteidigen gibt, nämlich dass wir in einer der wirklich liberalsten und freiheitlichsten Gesellschaften auf dem Planeten hier leben, und dass [diese Freiheit] zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren ernsthaft bedroht ist.“
Im Atlantic Talk Podcast spricht Gastgeber Oliver Weilandt mit Sigmar Gabriel darüber, vor welchen sicherheitspolitischen Aufgaben nicht nur der Staat Deutschland steht, sondern welche Verantwortung die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik haben. Denn die Kehrseite der Freiheit sei die Verantwortung. Dass der Krieg in der Ukraine „was mit uns zu tun hat und dass Russland eigentlich den Westen bekämpft und nicht nur die Ukraine – das glaube ich nicht, dass das schon angekommen ist“, so die Einschätzung des früheren Außenministers und heutigen Vorsitzenden der Atlantik-Brücke.
Er sieht die Wehrpflicht als eine gute Möglichkeit für eine wirkliche tiefgreifende gesellschaftliche Debatte, denn wenn praktisch in jedem Haushalt darüber gesprochen werden muss, „ob man zur Bundeswehr geht oder nicht und was das eigentlich bedeutet“, dann könne eine Gesellschaft „in der Diskussion auch den Konflikt irgendwann auflösen oder auch mit Mehrheit entscheiden“.
Damit die Gesellschaft die gegenüber der Vergangenheit fundamental veränderte Bedrohung auch versteht und diskutiert, ist Sigmar Gabriel auch für eine deutliche Sprache: Es gehe eben um mehr als Verteidigungsfähigkeit. „Verteidigungsbereit zeigt, ich kann mein Territorium verteidigen. Abschreckungsfähig ist: ‚Versuch’s erst gar nicht, das landet bei dir!‘ Dazu sind wir in der Lage“.
In dieser Folge des Atlantic Talk Podcasts geht es auch darum, wie die Europäerinnen und Europäer gemeinsam in der sich verändernden Welt agieren sollten. Oliver Weilandt und Sigmar Gabriel sprechen über die gleichzeitig stattfindenden Einigungs- und Spaltungstendenzen innerhalb Europas. Wie sollte sich die EU in der sich verschiebenden globalen Ordnung positionieren, wie zum Beispiel mit den BRICS-Staaten umgehen? Eine Forderung Deutschlands nach einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat sieht Gabriel als so konträr zur Auffassung des globalen Südens, dass er sich „wundere, dass sie immer noch vertreten wird“.
Der SPD-Politiker ist sich sicher, es werde rund zehn Jahre brauchen, die Bundeswehr wieder so auszurüsten, dass sie eine abschreckungsfähige Territorialarmee ist. Und das bedeute auch, dass Deutschland und Europa die Amerikaner länger brauchen, als gewünscht. Zugleich macht Gabriel deutlich, wie essentiell die Bereitschaft Deutschlands im europäischen wie transatlantischen Kontext ist, nach einem Waffenstillstand die Ukraine gegen einen möglichen erneuten Überfall Russlands abzusichern. Wenn Deutschland dann „nein“ sagen würde, „dann können wir einpacken“.
Im Grunde geht es in dieser Folge auf ganz unterschiedlichen Ebenen um Werte: Die Freiheit, aus der sich eine Verantwortung für die deutsche und europäische Gesellschaft für ihre Verteidigung ergibt, aber eben auch die Grundlagen, die Staaten miteinander verbinden und beispielsweise über viele Jahrzehnte das transatlantische Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika geprägt haben.
Gabriel beruft sich auf Churchill, wenn er sagt, dass es Freundschaften zwischen Staaten eigentlich nicht gibt, wohl aber gemeinsame Interessen. Das Wertefundament mit den USA werde möglicherweise „verdammt dünn“. Wenn es um gemeinsame Interessen geht, dann könnten Deutschland und die EU weiter mit den USA zusammenarbeiten. Darüber hinaus gelte es aber auch jetzt schon, eine ganze Reihe anderer internationaler Partner zu finden.
Auch in den transatlantischen Beziehungen habe es immer wieder Rückschläge gegeben. Trotzdem hätten sie sich am Ende immer zum Besseren weiterentwickelt. „Es gibt“, sagt Sigmar Gabriel, „keinen Grund zur Annahme, dass sozusagen jetzt das Ende der Geschichte erreicht sei.“(65) Indien zwischen Kaschmir-Krisen und Aufstieg zur drittgrößten Volkswirtschaft
26.7.2025 | 46 Min.In der Region Jammu und Kaschmir im Norden Indiens schwelt seit Jahrzehnten der Kaschmir-Konflikt. Wegen der regelmäßigen Gewaltausbrüche zwischen Indien und Pakistan und weil beide Staaten Atomwaffen besitzen, gilt Kaschmir als eine der gefährlichsten Regionen der Welt. Die letzte Eskalation Anfang Mai 2025 wurde ausgelöst durch einen Terroranschlag bei Pahalgam. Indien reagierte mit der „Operation Sindoor“, mit gezielten Militärschlägen auf mutmaßliche Terrorcamps in Pakistan, was wiederum zu Gegenangriffen Pakistans führte. Es kam zu schweren Kämpfen an der Grenze und zu gegenseitigen Anschuldigungen und Sanktionen. Inzwischen gibt es eine Waffenruhe, doch es herrscht weiter eine diplomatische Eiszeit.
In dieser Folge des Atlantic Talk Podcasts schauen Moderator Dario Weilandt und sein Gast Dr. Tobias Scholz (Stiftung Wissenschaft und Politik, zugeschaltet aus Indien) mit etwas Abstand auf diesen Kurzkrieg. Während Indien versucht, den indischen Teil Kaschmirs zu einer wirtschaftlich attraktiven Region zu machen, stellen sich islamistische Gruppen aus Pakistan dagegen, erläutert Dr. Scholz. Für den jüngsten Terroranschlag mache Indien jedoch nicht nur diese Terrorgruppen verantwortlich, sondern auch Pakistan direkt. So drohe aus einem Konflikt zwischen Indien und den Terrorgruppen ein bilateraler Konflikt zwischen Indien und Pakistan zu entstehen.
Dazu trägt auch bei, dass Indien den Indus-Wasservertrag ausgesetzt hat, der seit 1960 die Wasserverteilung der für Pakistan wichtigen Lebensader regelt. Wenn Indien das Wasser selbst nutzen würde, könnte das aus Sicht Pakistans eine rote Linie überschreiten. Das sei „eine schlechte Entscheidung Indiens aus globaler Perspektive“, urteilt Dr. Scholz. Denn durch das Aussetzen dieses internationalen Vertrags erscheine Indien, das eigentlich in einer Opferrolle ist, nun als aggressiver Akteur.
Wie gefährlich ist eine solche Situation in Anbetracht der Tatsache, dass Indien und Pakistan nicht nur über Nuklearwaffen verfügen, sondern darüber hinaus auch China einen Teil der Kaschmir-Region beansprucht und ebenfalls Nuklearmacht ist? Dr. Scholz sieht keine direkte Gefahr für den Einsatz von Nuklearwaffen, denn daran lasse derzeit keiner der drei Staaten ein Interesse erkennen. Die Gefahr gehe eher davon aus, dass durch nicht-staatliche Terrorgruppen bilaterale Konflikte mit der Zeit soweit eskalieren, dass dann eine nukleare Schwelle erreicht werden könnte. Vom „nuklearen Säbelrasseln Pakistans“ lasse sich jedoch weder die Regierung noch die Bevölkerung Indiens verunsichern.
Im letzten Teil richtet der Atlantic Talk Podcast den Blick auf Indiens wachsende Rolle in der Welt. Dr. Scholz betont, schon jetzt sei Indien ein Akteur, der Fachkräfte in alle Welt sendet. Wirtschaftlich hat Indien Japan bereits nach einigen Indizes überholt und könnte wohl in zwei bis drei Jahren zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. Gleichzeitig hat das Land immer noch rund 800 Millionen Einwohner, die von akuter Armut betroffen sind. Wie positioniert sich das Land außenpolitisch und was bedeutet das für die Beziehungen im Konfliktfeld zwischen den USA und China? Darum geht es ebenso wie um die erneuten Verhandlungen zwischen der EU und Indien über ein Freihandelsabkommen sowie Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaften. Dr. Tobias Scholz sieht ein Momentum dafür, dass die Verhandlungen diesmal gelingen könnten.- „EU und NATO sind wie zwei Gehirnhälften, die nicht genug miteinander kommunizieren“, sagt Dr. Nicole Koenig, Head of Policy der Münchner Sicherheitskonferenz, aber das ändere sich jetzt. Europa ist dabei, sich neu zu sortieren. Seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus haben sich die USA von ihrer Rolle als sicherheitspolitischer Garant Europas zurückgezogen. Europa muss sich selbst verteidigen können.
Was bedeutet das für einen hoffentlich baldigen Waffenstillstand in der Ukraine, für Europas eigene Verteidigung und für das europäische Sicherheitsgefüge insgesamt? Moderator Dario Weilandt spricht mit Dr. Nicole Koenig darüber, wer denn zur „Koalition der Willigen“ gehören könnte, die die Ukraine maßgeblich unterstützen will – auch mit weniger Unterstützung durch die USA. Zu den 30 Staaten zählen Frankreich, Großbritannien, viele EU-Staaten, aber auch Australien, Kanada und Japan. Zugleich gebe es aber auch Länder, die sagen, sie können nicht dabei sein, denn sie müssen zu sehr auf eigene Verteidigung achten.
Große Fähigkeitslücken sieht Koenig insbesondere in der Luft- und Raketenabwehr. Hier will die NATO ihre Kapazitäten um 400 % steigern. In der Produktion von Munition ist Russland bislang noch deutlich schneller als die NATO. „Russland produziert in drei Monaten so viel wie die ganze Nato in einem Jahr!“
Die Europäische Union hat neue Programme aufgelegt: „ReArm Europe“ und das neue SAFE-Programm („Security Action for Europe“) mit 150 Milliarden Euro für die gemeinsame Rüstungsbeschaffung. Das werde manchen EU-Ländern helfen, aber es sei klar, „der Großteil der Investitionen muss auf nationaler Ebene passieren“. Am Ende sei die Frage, um wie viel werden sich die Nationalstaaten verschulden.
Die Expertin für EU-Außen- und Sicherheitspolitik sagt, es habe in den vergangenen drei Jahren viele „Déjà-vu-Momente“ bei europäischen Veranstaltungen zur Verteidigung gegeben: „Eigentlich wussten alle, was es braucht – größere gemeinsame Beschaffungen, Stückpreise senken, langfristige Verträge, mehr Ressourcen –, aber man hatte das Gefühl, so richtig aufgewacht ist man nicht.“ Seit diesem Jahr beobachte sie jedoch ein höheres Tempo.
Wie sollte die neue deutsche Bundesregierung agieren? Und schafft es die Europäische Union im Bereich Sicherheit und Rüstung mit einer Stimme zu sprechen und dabei ihre demokratischen Werte nach innen und außen zu vertreten?
Auch wenn nicht klar ist, wie sehr und wie schnell sich die USA tatsächlich aus Europa zurückziehen, zwischen strategischer Autonomie Europas – vielleicht sogar „als letzte Bastion der liberalen Demokratie“ – und guten transatlantischen Beziehungen sieht Dr. Nicole Koenig jedenfalls keinen Widerspruch.
Weitere Regierung Podcasts
Trending Regierung Podcasts
Über Atlantic Talk Podcast
Interessante Gäste, die ihre topaktuellen Informationen und ihr profundes Hintergrundwissen zu internationalen Sicherheitsfragen mit uns teilen.
Im Atlantic Talk kommen Menschen zu Wort, die sich beruflich mit den Veränderungen von Sicherheitslagen befassen, die Nuancen aufspüren; Experten, die diplomatische oder militärische Verschiebungen bewerten und die ihre Analyse dann in politische Handlungsoptionen umsetzen.
Immer am letzten Donnerstag jeden Monats!
Podcast-WebsiteHöre Atlantic Talk Podcast, Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.de-App

Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen


Atlantic Talk Podcast
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.